Ein Oberbürgermeister für eine vielfältige Stadtgesellschaft

Nächste Woche wird in einer Stichwahl über das Amt des Oberbürgermeisters von Hannover entschieden. Zur Wahl stehen für die Grünen Belit Onay und für die CDU Eckhard Scholz. Beide Bewerber hatten sich im ersten Wahlgang gegen acht weitere Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt und damit die über siebzigjährige Dominanz der SPD gebrochen. Sowohl Onay als auch Scholz liegen mit 32,2 Prozent gleichauf, es geht also auf Augenhöhe in die Zielgerade.
Das Besondere an der Konstellation ist nicht allein die richtungsweisende Frage, ob auch in einer norddeutschen Großstadt ein grüner Oberbürgermeister möglich ist sondern es sind vor allem die Biographien der beiden Kandidaten, die dem Wahlkampf bundespolitische Beachtung geben und ein genaueres Hinsehen erfordern.

Scholz repräsentiert als ehemaliger VW-Vorstand die etablierte Gesellschaft und verweist dementsprechend auch stolz auf seine Erfolge. Er präsentiert sich als “Der Macher”, der mit seiner Erfahrung aus der Welt der Automobilproduktion und mit seinem Beruf des Entwicklungsingenieurs die Stadt Hannover mit einem “Neustart” ähnlich einem liegen gebliebenen Auto wieder in Gang bringen will, weg von der sozialdemokratischen Tradition des Aushandelns, hin zu einer funktionalen Stadt.
Onay hingegen kommt aus einer Familie mit türkischem Migrationshintergrund, die in Goslar mit einer Gaststätte Fuß gefasst hat und Onay Schule und Studium ermöglichte. Onay hat in einer Suchbewegung seine politische Heimat bei den Grünen gefunden. Als Jurist wurde er Landtagsabgeordneter und übernahm die anspruchsvolle Aufgabe als innenpolitischer Experte seiner Landtagsfraktion. Die Stadt Hannover sieht er in einem “Aufbruch”, den es gemeinsam zu gestalten gilt. Er sieht sich dabei in der Rolle des “Zuhörers” und “Brückenbauers”.

Nicht nur das, die Gespräche haben auch dazu geführt, meine eigene Vorurteile kennenzulernen und zu revidieren. Die Bilder, die wir über Menschen im Kopf haben, die wir nicht kennen, sind häufig enggeführt auf Phänomene, die medial skandalisiert werden. Für das gegenseitige Verständnis braucht es Menschen, die vermitteln können, die die Fähigkeit haben, Menschen zusammen zu bringen und Konflikte zu überwinden. Daran wird sich der neue Oberbürgermeister messen lassen müssen. Darin liegt eine Chance für Hannover, mit einem Oberbürgermeister die Stadt zu entwickeln, der selber Migrationserfahrung hat.
Ein grüner Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund wäre auch ein Zeichen, wie ernst wir das Leistungsversprechen einer durchlässigen Gesellschaft nehmen. Welche Chancen haben Menschen in unserer Stadt, sind Bildungsaufstiege möglich oder verhindern verkrustete, starre Strukturen und Klassenbarrieren die Entfaltung der Potenziale? Nur eine Stadt, die den gegenseitigen Respekt vor Herkunft, Aussehen und Dialekt stellt, kann den zukünftigen Herausforderungen standhalten und sich mit allen Kräften gleichermaßen entwickeln.
In der Forschungsstudie zu Teilhabe und Partizipation (siehe Kasten) sind die zwei größten Zuwanderungsgruppen, türkeistämmige Deutsche und Spätaussiedler, zu Wort gekommen. Ein Auszug aus der Studie (Seite 282ff.) und Originalzitate zeigen, welche Fragen formuliert werden und auf welche spannende Reise sich nicht nur unsere Stadt begibt:
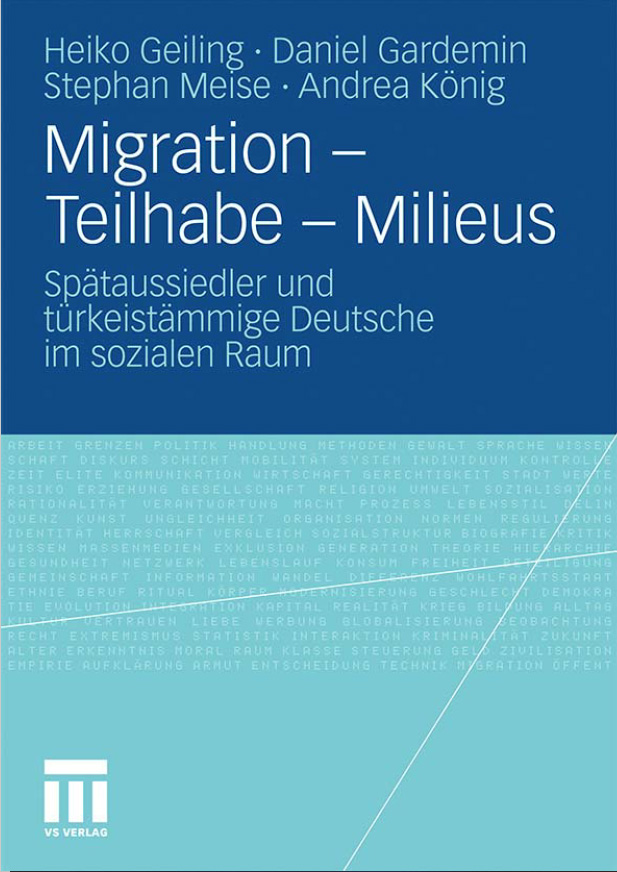
Wir haben mit unserer Untersuchung einen Einblick in die Lebenswelten der beiden größten Einwanderergruppen erhalten. Unsere Typologie der Milieus mit Migrationshintergrund verweist auf systematische soziale Differenzierungen, die sich über ethnische Zuschreibungen hinwegsetzt. Wir beschreiben die Alltagspraxis, die Wünsche und Ziele dieser Milieus und es wird sichtbar, wie stark die Befragten sich zur Mehrheitsgesellschaft hin orientieren. Dabei erfahren wir von den Barrieren und Widerständen, die eine erfolgreiche Etablierung bremsen. Andererseits zeigen uns die Befragten auch Wege auf, die eine Vernetzung in die Mehrheitsgesellschaft erleichtern. Immer wieder wird von den eigenen Bildungsanstrengungen und Bildungserfolgen berichtet. Insbesondere die in Deutschland erworbenen Bildungstitel, dort wo sie eine gerechte Bewertung erfahren, führen zu dauerhafter Anerkennung. Es offenbart sich zum Ende unserer Untersuchung, wie wesentlich die wechselseitigen Bezüge der Autochthonen und Allochthonen sind. Beide Seiten können nicht mehr losgelöst voneinander betrachtet werden. (…) Der größte Teil der Deutschen mit Migrationshintergrund, so unsere Vermutung, ist bereits längst in der Mehrheitsgesellschaft angekommen. Der Antagonismus zwischen Alteingesessenen und neuen Deutschen wird nur dort nachwirken, wo reale oder phantasierte Situationen der Konkurrenz sich zuspitzen. Noch haben sich relative wenige Gruppen mit Migrationshintergrund in der oberen Mitte der Gesellschaft etablieren können. In den Elitemilieus haben wir bis auf einzelne Ausnahmen, die gerne auch als Beleg für die vermeintliche Offenheit der führenden gesellschaftlichen Milieus herhalten müssen, kaum Befragte mit Migrationshintergrund entdecken können. Es zeichnet sich aber ab, dass der partielle Aufstieg von Zuwanderern in die gesicherten Positionen der oberen Mitte vor allem die traditionelleren der Mehrheitsmilieus unserer Gesellschaft unter Druck setzt. Sie sind nicht darauf vorbereitet, Zuwanderern auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Die Zuspitzung des öffentlichen Diskurses weist darauf hin, dass sich auch die Mehrheitsgesellschaft in einer neuen Positionierungsdynamik befindet. Es bleibt Zugewanderten wie Autochthonen gar nichts anderes übrig, als sich auf diese Auseinandersetzung einzulassen. Vor allem die Geschwindigkeit der Bildungsaufstiege der Zuwanderer führt zu Konkurrenzsituationen. Diejenigen Milieus der Mehrheitsgesellschaft, die in den Jahrzehnten der Massenarbeitslosigkeit versucht haben, abgeschlossene Reproduktionsräume für sich aufzubauen, geraten in eine Defensive, da die Dynamik inzwischen bis in ihre Milieus reicht und Migration nicht mehr auf unterschichtete Orte des sozialen Raumes beschränkt bleibt. Der immer wiederkehrende Hinweis auf Ethnizität, Segregation, Idiome und religiöse Orientierung ist Ausdruck entsprechender gesellschaftlicher Abwehr und Schließung. Dabei fungieren die askriptiven Merkmale als abwertendes »negatives Kapital«. Doch es zeigt sich auch die andere Seite der Mehrheitsgesellschaft. In vielen Branchen werden Zuwanderer gebraucht. Sind es bislang vorwiegend die gering bezahlten und körperlich belastenden Arbeitsverhältnisse, so besteht daneben heute ein Bedarf an gut qualifizierten Facharbeitern, Handwerkern, Ingenieuren und Dienstleistern. Hier ist die Mehrheitsgesellschaft zunehmend auf Zuwanderer angewiesen und muss sich ihnen gegenüber öffnen.
Es bildet sich – so unsere Beobachtung – eine wesentliche Schnittstelle beiderseitiger Interessen. Die Leistungsgesellschaft kann hier ihr Versprechen einlösen und gleichzeitig die Bildungsleistung derjenigen Zuwanderer anerkennen, die mangels anderer Ressourcen einzig auf Bildungserwerb setzen können. Unsere Untersuchung verweist darauf, wie stark über die einzelnen sozialen Milieus hinweg das meritokratische Prinzip bei den neuen Deutschen verinnerlicht ist. (…) Insofern befinden wir uns qualitativ an einem neuen Ausgangspunkt, von dem aus die Milieus der Mehrheitsgesellschaft mit den Milieus mit Migrationshintergrund zusammenwachsen können.
Noch müssen wir aber ganz deutlich feststellen, dass viele der von uns Befragten Einschränkungen und Rückschläge erleben, weil sie sich in einer doppelten Benachteiligung befinden. Ethnizität und Ressourcenungleichheit wirken dem Zusammenwachsen der Gesellschaft entgegen. Leistungs- und Bildungsorientierung werden von der Mehrheitsgesellschaft nicht ausreichend gewürdigt und führen nur selten zu deutlich sichtbaren sozialen Aufstiegen.
Die meisten der von uns Befragten sehen sich in diesem Prozess als Grenzgänger zwischen der Herkunftswelt und einer zukünftigen offenen Gesellschaft, in der sie frei eine ihren Fähigkeiten entsprechende Position einnehmen können. Dabei geht es viel weniger um Aufstiegswege als um die Frage der langfristigen Sicherung des Arbeitsplatzes und die Aussicht auf respektable Lebensbedingungen für die Familie und die Nachkommen.
In dem Kräftefeld einer sich verändernden Gesellschaft müssen sich Alteingesessene wie Zugewanderte an allen Orten des sozialen Raumes mit Dynamiken und damit verbundenen sozialräumlichen Verlagerungen auseinandersetzen.
In der unteren Mitte der Gesellschaft haben die Menschen bereits langjährige Erfahrungen mit Zuwanderern gemacht, denn hier befindet sich die Mehrheit der Zugewanderten. Die moderneren Migrantenmilieus der unteren Mitte haben, so unsere Einschätzung, aus heutiger Sicht die besten Möglichkeiten, mit den Milieus der Mehrheitsgesellschaft zusammenzuwachsen.
Wir gehen davon aus, dass sich an Arbeitsplätzen, Bildungsstätten,
in Quartieren und in Familien Überschneidungen der Lebenswelten bilden, die bereits heute Grundformationen neuer sozialer Milieus darstellen. Dieser Prozess steht den sozial gehobenen autochthonen Milieus noch bevor. Sie haben die Potenziale der Zuwanderer verkannt und die wenigen migrantischen Vertreter in Parteien, Wirtschaft, Verbänden und Kultur lediglich als Ausnahmen betrachtet. Diese aber als Repräsentanten einer sich normalisierenden Entwicklung zu sehen, fällt der Mehrheitsgesellschaft noch schwer. Dabei trägt gerade sie eine erhebliche Verantwortung, da ihre Haltung gegenüber der pluralen Einwanderungsgesellschaft entscheidende Auswirkungen auf die Transformation der Gesellschaft hat. Vor allem die Funktionsträger der Mehrheitsgesellschaft müssten sich für eine systematische Einwanderungspolitik stark machen, um diesem Transformationsprozess zu einem institutionalisierten Rahmen zu verhelfen. Erst die Loslösung von nationalen oder konfessionellen Zuschreibungen öffnet den Blick auf die strukturellen Ungleichheiten, die nicht allein die sozialen Milieus mit Migrationshintergrund betreffen. Gerade den Wunsch nach Normalität und Gleichbehandlung haben die Zugewanderten uns gegenüber immer wieder artikuliert – er könnte dazu beitragen, die Debatte zu versachlichen.
Auswahl an Zitaten:
»Und wir als Migranten machen uns da wahrscheinlich andere Gedanken und denken, wir sind immer die Sündenböcke. Was passiert denn, wenn es hier wirklich mal hart auf hart kommt? (…) Mir ist wichtig, dass ich mich schon auf den Staat verlassen kann, dass ich weiß, dass ich hier sicher bin. Ich denke, das wünschen wir uns alle irgendwo. Dass mehr Verantwortung übernommen wird. Es wird ja schon viel gemacht, denke ich, aber trotz alledem– (…) Ich möchte eine Zukunftsperspektive für meine Kinder, ich möchte Bildungschancen. Und da ist es natürlich der Staat in erster Linie, der da auch was unternehmen muss. Und da wünsche ich mir, dass sie da aufmerksamer sind und gut beobachten und vielleicht einfach auf die Basis hören und gucken, ob man bestimmte Konzepte auch noch ein bisschen abändern könnte, damit alles weiterhin so positiv verläuft. (…) Es ist in allem so, dass alle mitwirken müssen. Es ist ja so eine Kettenreaktion quasi. Es kann nicht nur die Politik sein. Wir müssen genauso mitwirken. Ich denke, es gibt viele Bürger, viele Menschen, die schon viel tun.« (Lejla M.)
»Allgemein wünsche ich mir, dass wir Menschen einfach friedlich zusammen leben können. Und menschlich, auf jeden Fall miteinander.« – Interviewer: »Und wie kann das funktionieren?« – »Austausch, also kommunizieren. Mehr nicht. Kommunizieren und Respekt gegenüber Anderen zeigen, dann klappt alles. (…) Aber ich denke mal, man muss politisch sein. Um mitreden zu können, muss man sich mit Politik beschäftigen. Wenn nicht, dann hat man selbst schuld, wenn heutzutage alles gegen uns entschieden wird. Dann muss man schon was sagen.« (Çaba D.)
»Ich persönlich sehe das als eine Herausforderung, dass es als Manko gilt, einen türkischen Namen zu haben. Und ich glaube, ich habe die Chance genutzt, die mir das Bildungssystem gegeben hat. Aber ich habe auch dafür gekämpft. Es war kein leichter Weg.« (Kadir L.)
»In der Elternzeit habe ich mich immer wieder aktiv bewegt im Stadtteil B. Ich habe für den Sport- und Musikverein Leute mit Migrationshintergrund geworben, habe Krabbelgruppen gegründet, auf Eigeninitiative, habe bei der AWO Senioren betreut. Ich war immer in Bewegung, also ich, ich hab meine Kinder, quasi, wie eine mobile Mutter, die überall irgendwo drin war. Aber nicht für Geld oder so. Ich wollte einfach nur beweglich bleiben.« (Hatice I.)
»Ich möchte auch gerne den Frauen ein Stück weit etwas mitgeben. In meinen Augen muss man einfach als Frau auf den eigenen Füßen stehen können. Man muss nicht nur sagen können: Ich hab einen Mann, der kann hier alles machen. Man muss sich als Frau auch viel trauen können. (…) Es gibt wirklich auch sehr viel Frauen, die sich nicht viel trauen, die wirklich – ich weiß nicht, ich finde es einfach unmöglich – noch nicht mal einen Arztbesuch erledigen können alleine. Wenn ich mal zum Zahnarzt
gehe, da nehme ich doch nicht meinen Mann mit, da kann ich doch alleine gehen! Aber nein, die sind total gebunden, die gehen noch nicht mal alleine einkaufen oder alleine weg, oder gemeinsam mit einer Freundin frühstücken. Für die ist so was unmöglich. (…) Klar, das ist das A und O in meinen Augen, wenn man hier lebt: dass man eine Ausbildung hat, dass man eine Arbeitsstelle hat, das ist für mich sehr wichtig, für mich persönlich.« (Nuran O.)
»Ich glaube, Freiheit, das ist das stärkste Gefühl, was ein Mensch haben kann. Freiheit verbinde ich damit, dass ich frei bin, unabhängig bin, meine Entscheidungen selber treffen kann. Mein Leben leben kann, wie ich es mir vorstelle und soweit die finanziellen Mittel es zulassen. Das heißt für mich Freiheit. Die Freiheit, meine Meinung zu sagen. Freiheit – ein schönes Wort eigentlich. (…) Also diese Lebensphilosophie ist für jeden wichtig, also nach meinem Empfinden sollte jeder nach seiner eigenen Fasson leben, wenn es mein Leben nicht beeinträchtigt.« (Edgüer F.)


